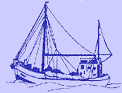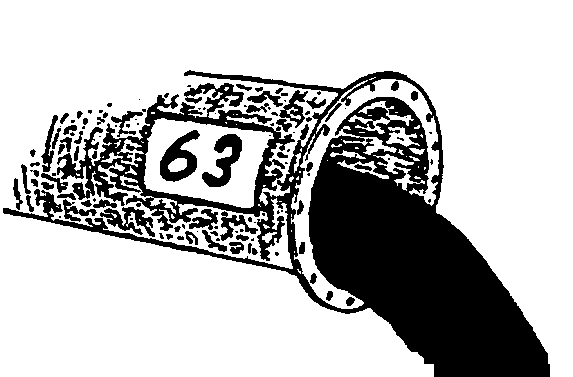 Problem:
Schadstoffe Problem:
Schadstoffe
Förderkreis
»Rettet die Elbe« eV,
Hamburg
Ergebnisse des Zustandsberichts
2005
Gemäß der WRRL sollen alle Belastungen (pressures)
auf die Elbe-Umwelt, alle direkten und indirekten Einträge von
Schadstoffen in die Gewässer, aufgezeichnet und
geprüft werden, welche Wirkungen sie auf den
ökologischen und chemischen Zustand haben. Die meisten
Informationen, die für einen Zustandsbericht unter der WRRL
benötigt werden, sollten aus der Überwachung von
Einleitungen und der Gewässer bekannt sein, die auf Grund der
der WRRL vorangegangenen Gesetze durchgeführt wurde. Diese
Informationen wurden im Zustandsbericht stark reduziert, der von der
IKSE mit Billigung der Umweltminister im März 2005
herausgegeben wurde.
Die
tschechischen Behörden veröffentlichten im
Zustandsbericht gar keine Einleitungsdaten. Auf deutscher Seite wurde
unter dem Schlagwort „Signifikanz“ die Zahl der
Verschmutzer und die der Schadstoffe eingeschränkt, indem
entweder die einleitende Anlage als zu klein eingestuft wurde, oder
weil andere EU-Regulierungen für bestimmte Typen von
Einleitern nur eine kleine Zahl von zu messenden Parametern verlangen.
Kläranlagen
wurden in den Zustandsbericht aufgenommen, wenn ihre Kapazität
2000 Einwohnergleichwerte überschreitet. Die große
Zahl kleiner Kläranlagen und häuslicher
Klärgruben, die erheblich zur Gesamtfracht der
Abwässer beitragen können, wurde nicht einmal
summarisch aufgenommen. Nur fünf Parameter – BSB,
CSB, N, P und teilweise AOX – repräsentieren die
Einleitungen, was aber kein realistisches Bild ergibt. Vor allem in
Großstädten leiten viele gewerbliche und
städtische Anlagen Schadstoffe ins kommunale Abwasser, die in
den Anhängen VIII und X der WRRL aufgeführt werden.
Mehr oder weniger abgebaut verlassen sie die Klärwerke.
Ungenügende EU-Regulierungen für kommunale
Abwasserbehandlung dürfen keine Entschuldigung sein, die
prioritären Schadstoffe im Abwasser nicht zu bestimmen.
Für
Industrieanlagen werden die Regeln von EPER angewandt, nach denen nur
wenige Betriebe die Signifikanzschwelle überschreiten. Alle
kleineren Anlagen werden vernachlässigt und nicht einmal
summarisch erfasst. Obwohl zumindest für EPER-Anlagen
Emissionen in die Luft bekannt sind, wird deren Anteil an der
Gewässerbelastung nicht berücksichtigt.
Diffuse
Verschmutzungsquellen, wie städtische
Regenentwässerung, Bodenerosion, Versickerung aus
kontaminierten Flächen, Verklappung von Baggergut in
Wasserstraßen, sowie die Landwirtschaft werden unzureichend
beschrieben und quantifiziert.
Die
Wasserwerke am Rhein kritisierten generell alle Zustandsberichte, die
chemische Belastung zu vernachlässigen, und so als nicht
angemessen, um sicherzustellen, dass die Wasserwerke jederzeit mit
einfachen und natürlichen Aufbereitungsmethoden Trinkwasser
liefern können.
Die Belastungsdaten im Elbe-Zustandsbericht von 2005 genügen
nicht, die nächsten Arbeitsschritte nach der WRRL zu meistern.
Aufbau eines Schadstoffkatasters
für alle Quellen
In einer ihrer ersten Arbeiten hat die IKSE die
potentiellen Quellen von Schadstoffen bei Unfällen
zusammengestellt. Die „alten“ Mitgliedsstaaten der
EU begannen vor Jahren, das „European Pollutant Emission
Registry“ (EPER) aufzubauen. Im Rahmen der Aarhus Konvention
wurde 2003 das Protokoll über das „Pollutant Release
and Transfer Register“ (PRTR) unterzeichnet, und zwar auch
von den Staaten im Elbeeinzugsgebiet. Die Daten von EPER und PRTR sind
von Deutschland und Tschechien im Internet veröffentlicht,
wobei die Informationen noch nicht vollständig sind. Die
Stockholm Konvention bindet die Vertragsstaaten, die
„Priority Organic Pollutants“ (POPs) zu
eliminieren. Die EU-Richtlinie 96/61/EC zur „Integrierten
Vermeidung von Umweltbelastungen“ (IVU) verpflichtet die
Industrie, Schadstoffbelastungen mit den besten verfügbaren
Techniken zu vermeiden oder zu minimieren. Die Chemikalienpolitik der
EU unter „REACH“ wird dafür sorgen, dass
über Umweltrisiken durch heute oder künftig
existierende Schadstoffe besser informiert wird.
Die oben genannten Ansätze müssen von der IKSE,
nationalen und lokalen Behörden genutzt werden, um ein
vollständiges und detailliertes Kataster aller
Schadstoffeinträge aufzustellen, es dem Zustandsbericht
hinzuzufügen, und laufend zu aktualisieren und zu verfeinern.
Die Erhebung und Auswertung statistischer und geografischer Daten und
die Methoden der Modellierung sind zu verbessern, um die
Schadstoffeinträge aus diffusen Quellen zu bestimmen.
Funktion des Katasters
für
Monitoring und Bewirtschaftungsplan
Aus
dem Schadstoffkataster muss das
Gewässer-Überwachungsprogramm abgeleitet werden, um
die Auswirkung von Einträgen zu bestimmen, den Eintrag aus
bekannten Quellen mit der Fracht aus einem Teileinzugsgebiet
gegenzuprüfen, und gegebenenfalls unbekannte Quellen zu
ermitteln. Überwachungsprogramme müssen an den
Fortschritt bei Produktion und Vermarktung potentiell
schädlicher Chemikalien angepasst werden.
Das
Kataster dient dazu, prioritäre Verschmutzungsquellen zu
identifizieren. Jede Quelle muss beurteilt werden, wie die
Verschmutzung reduziert werden kann. Drei Strategien stehen zur Wahl:
- beste
verfügbare Techniken der Behandlung von Abprodukten einsetzen
- gefährliche
Stoffe und Produktionsprozesse ersetzen
- Schadstoffe
verbieten.
Das
Vorsorgeprinzip soll das primäre Kriterium sein, gegen
Schadstoffe vorzugehen. Man darf nicht warten, ob
Qualitätsnormen
im Gewässer überschritten oder eingehalten werden.
IKSE,
nationale und lokale Behörden sollen
regelmäßig
öffentlich berichten, welche Fortschritte gemacht werden, die
Belastungen zu mindern, und welche Defizite bestehen.
Beispiele
SPOL
Chemi, Usti nad Labem,
produziert
Natronlauge und Chlor im Amalgam-Verfahren, das Quecksilber
erfordert. Die Methode sollte durch die quecksilberfreie
Membran-Technik ersetzt werden. Aus Chlor wird eine Vielzahl von
chlorierten organischen Verbindungen erzeugt, was zu Emissionen
dieser und ihrer Nebenprodukte führt. Die Frage ist, welche
Stoffe vollständig eliminiert werden sollten (POPs und
ähnlich
gefährliche Stoffe), und ob die beste verfügbare
Technik in
allen Produktionszweigen angewandt wird.
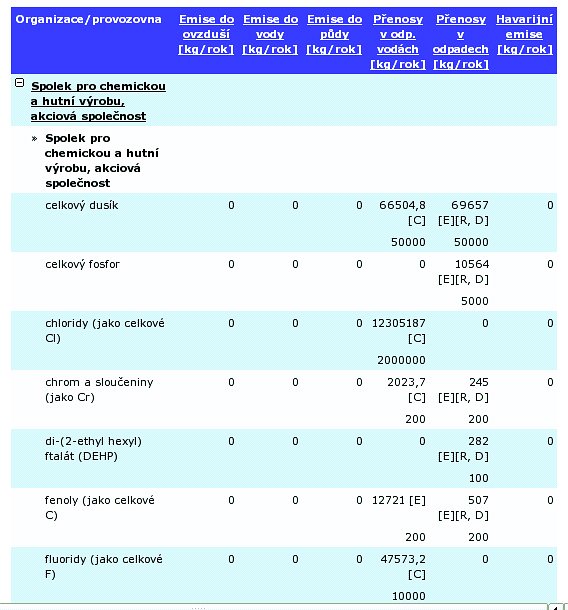
Auszug
des PRTR Datenblatts der Spolchemi, Usti nad Labem
Norddeutsche Affinerie, Hamburg,
ist die größte Kupferhütte Europas. Die
Verschmutzung entsteht hauptsächlich durch metallhaltigen
Staub.
Die Umweltbehörde Hamburg hat den Staubniederschlag auf einer
Fläche von 5*5 km² um den Betrieb seit vielen Jahren
gemessen. Bessere Reinigungs- und Rückhaltetechnik
führte
zu eindeutig weniger Belastungen auf Boden- und
Wasseroberflächen.
Weitere Verbesserungen sind jedoch immer noch notwendig. Obwohl die
Hamburger Behörden den Staubeintrag messen,
berücksichtigen
sie ihn nicht im WRRL-Zustandsbericht.
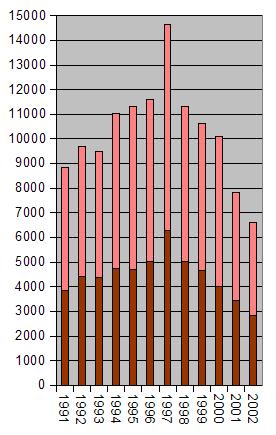
Integrierte Kupferdeposition (kg auf das Untersuchungsgebiet) im Bereich der NA
(Auswertung der Behördendaten durch Förderkreis
»Rettet die Elbe« eV)
Intensive Viehhaltung
Mehrere tausend Schweine in einer Anlage, dass ist die
Dimension der industriellen Fleischproduktion. Die deutsche
EPER/PRTR-Karte zeigt eine erhebliche Dichte solcher
Großbetriebe
im Elbegebiet. Dabei deutet die relativ dünne Besetzung im
Tideelberaum vermutlich nur auf eine unterschiedliche Struktur hin,
nämlich viele kleine Betriebe unterhalb der PRTR-Schwelle,
aber
nicht auf eine geringere Belastung.
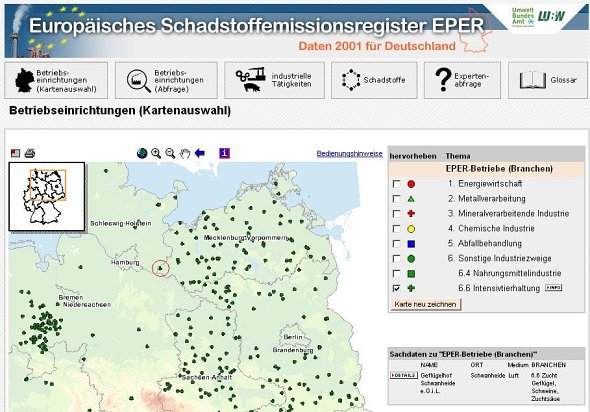
Für den rot eingekreisten Betrieb östlich von
Hamburg beispielsweise nennt das EPER/PRTR eine Emission von 28 t
Ammoniak pro Jahr – in die Luft. Das Güllemenge, die
darin
enthaltenen Pflanzennährstoffe und Tierarzneimittel, und ihr
Verbleib werden nicht angegeben. Obwohl sie Grund- und
Oberflächenwasser erheblich gefährden, ist das Wissen
darüber hoch defizitär.
Mehr Information
WFD Status Report 2005 CZ, DE,
IKSE/MKOL
Kritik am Status Report
Elbe
Kurzfassung - Langfassung
Pollutant
Release and Transfer Register (PRTR und EPER) DE
Pollutant
Release and Transfer Register IRZ - Integrovaný registr
znečišťování -
CZ
Cleaner
Production
Germany – Hinweise zu „Bester verfügbarer
Technik“,
Umweltbundesamt
Schwermetalldeposition im Umfeld der
Affi
erstellt Februar 2007
 Hauptprobleme des Elbegebiets Hauptprobleme des Elbegebiets
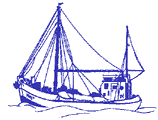 Homepage
Rettet die Elbe Homepage
Rettet die Elbe
|

 rettet-die-elbe.de
rettet-die-elbe.de